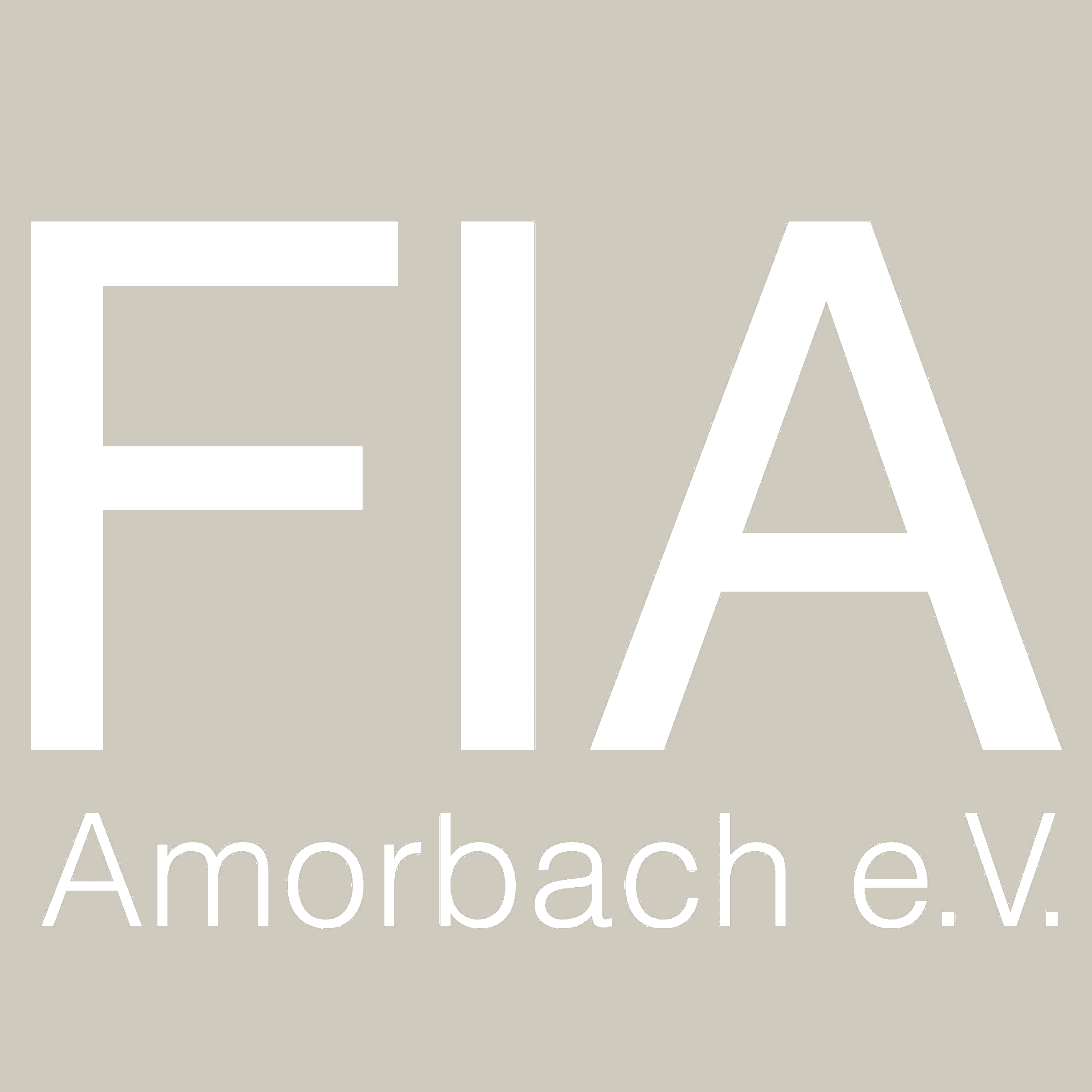Das geistlich-weltliche, urbane Dorf Amorbach
von REINHART BUETTNER
Eine groBe barocke Abtei im Odenwald, das passte für mich überhaupt nicht zusammen. Im meinem Kindergemüt war der Odenwald vor allem Hessisch und protestantisch, ländlich-tölpelhaft wie sein Dialekt, die Gegend in die man gelegentlich Ausflüge machte‚ in der es handfest zuging, mit der großen Ausname Erbach-Michelstadt. Da war vieles anders, da ging es ästhetisch-feudal zu, da dominierten Renaissance und Barock, die Grafen waren katholisch, quasi südländisch und reicher als andere, also fremd.
Das weiter östlich, im Mainfränkischen gelegene Amorbach stellte in meiner Wahrnehmung die Steigerung dieser Fremdheit dar, nicht nur war sein Name rätselhaft, sondern auch sein Schloss, das kein Schloss war, sondern ein Konvent, sein Fürstenhaus, das nicht bodenständig war, sondern dem die Besitzungen als Entschädigung für Verluste in den Napoleonischen Kriegen zugesprochen worden war. Eine fremdartige Gemeinde, hinter deren Ecken stets die Ränke und Ungereimtheiten der Weltgeschichte lauern.
Die Geschichte des Klosters Amorbach zeigt, wie die anderer zu Reichsklöstern und Verwaltungszentren aufgestockten Benediktiner Abteien, die zahlreichen politische Machenschaften des Mittelalters und merkwürdigerweise hat sich an diesen Orten die Mentalität eines Zentrums bis auf den heutigen Tag erhalten, obwohl die Gegenwart nichts mehr wirklich Substantielles davon enthält.
Dass ausgerechnet der Frankfurter verwöhnt-kultivierte Weinhändlersbub Theodor Wiesengrund und spätere Philosoph Theodor W. Adormo diesen Ort als „Heimat“ bezeichnen konnte, in dem er die Sommer seiner Kindheit und Jugend verbrachte, ist in vielfacher Hinsicht bezeichnend. Er erlebte hier eine „bezweifelbare Idylle“, ein „urbanes Dorf“ mit all seinen Widersprüchen und jene „gebildete Bürgerlichkeit“, die ihn ein Leben lang begleiten sollte.
Dieser Exekutant seines Arbeitgebers Max Horkheimer, der sich nur mühsam aus dessen Schatten herausarbeiten und letztlich emanzipieren konnte, blieb bei aller Kultur-und Gesellschafiskritik, Intellektualität und linkslastigen Diktion ein ambitionierte Bürger. Daran konnte auch der Einfluss seiner klugen und weltläufigen Frau Margarete Karplus nichts ändern, oder der Freund Siegfried Krakauer, der dem als „gescheiterter Künstler“ aus Wien zurückgekehrten Teddie in einem Brief riet: „Jetzt nicht die gesamte Kunst in Bausch und Bogen zu verdammen“.
Adornos nicht-originelles Leben, seine problematische Ästhetik, seine Abneigung allem Experimentellen und Extremen gegenüber und sein Hang zur Seilschaft und Sicherheit sind untrügliche Zeichen einer tief wurzelnden Bürgerlichkeit, weit entfernt von allem Revolutionären, selbst wenn der Begriff gelegentlich als philosophisches Argument Verwendung findet.
Adornos Bürgerlichkeit, respt. GroBbürgerlichkeit und seine apolitische Intellektualität hielt ihn von jeglicher Parteiigkeit ab, und führte wie die der gesamten sogenannten „Frankfurter Schule“ letztlich zur enttäuschten Abkehr der jungen Linken der Studentenbewegung.
Das Bonmot : „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ regt zwar zu heftigem Nachdenken an, fordert zu Definitionen des richtigen Lebens und des falschen heraus, verweist aber auch bei jedem Versuch einer Rechtfertigung dieser Behauptung auf die vorgängige und abhängig machende Wertung dessen, was richtig und falsch sei.
Eine aussichtslose Ethik im Gewand eines Bonmots ~wo er das wohl gelernt hat, der sentimentalische Verfasser der „Minima Moralia“?
Womöglich im „gefühlten Rätsel Amorbach“, jener „bezweifelbaren Idylle“ seiner Kindheit und Jugend.
Text: Gefühltes Rätsel
Das geistlich-weltliche, urbane Dorf Amorbach
von REINHART BUETTNER
Link zur Website von Reinhart Büttner