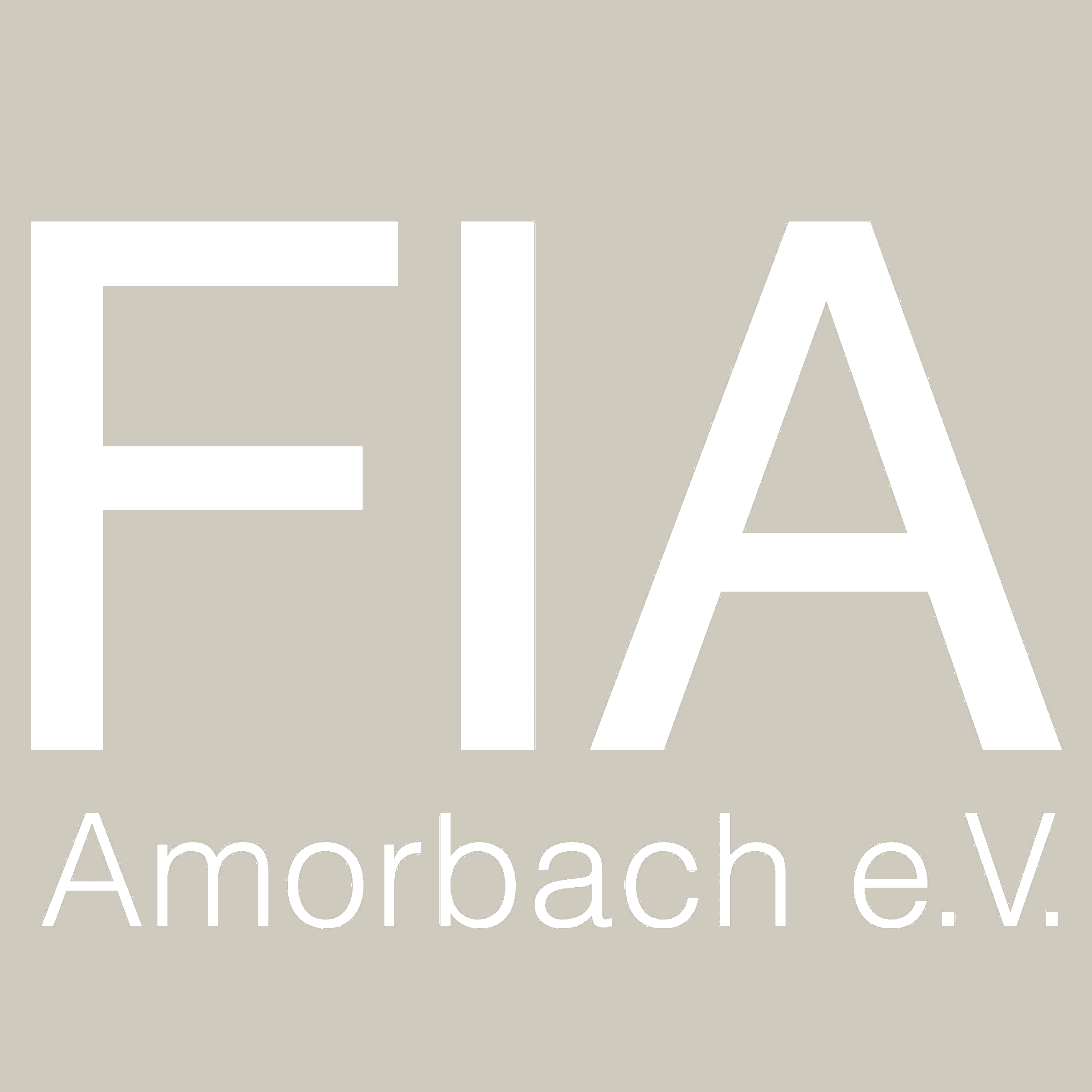über Adorno nach Amorbach
Auftaktveranstaltung Digitales Adorno-Archiv Sonntag, 10. August 2025 um 11 Uhr, Altes Rathaus Amorbach, Foyer THOMAS MEINECKE ÜBER ADORNO NACH AMORBACH.
Der vielfach ausgezeichnete Autor, Musiker und DJ liest ortsbezogene Passagen aus seinem Buch ODENWALD
Fotos: Klaus Sartorius
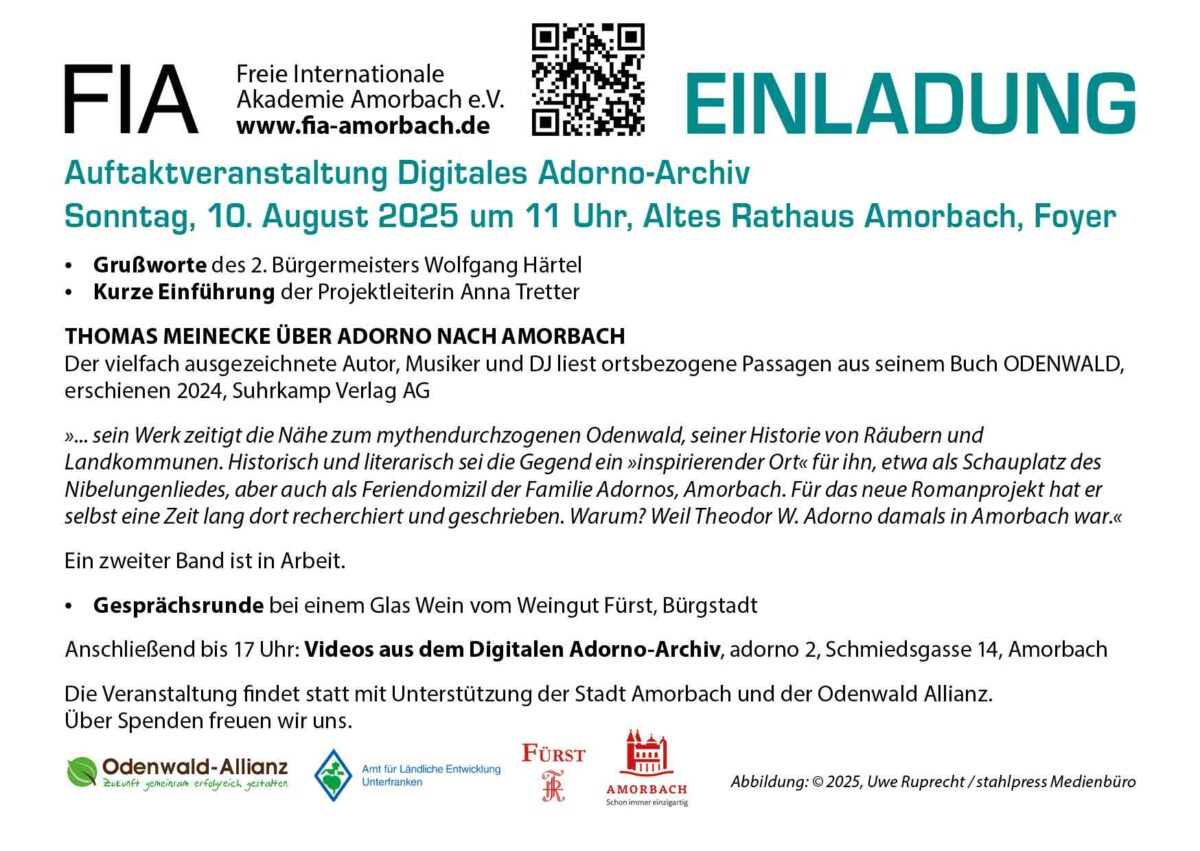

Thomas Meinecke wurde 1955 in Hamburg geboren und lebt heute bei München und in Marseille. Er ist Schriftsteller (zahlreiche Romane und Erzählungen seit 1986 im Suhrkamp Verlag, aktuell „Odenwald“, 2024), Musiker (mit seiner 1980 gegründeten Band F.S.K., deren Alben seit 2008 auf Daniel Richters Buback Label erscheinen (aktuell „Topsy Turvy“, 2023); seit 1998 viele gemeinsame elektronische Projekte mit Move D.), Radio-DJ (eigene Sendung im Bayerischen Rundfunk 1985-2021) und auch DJ in urbanen nächtlichen Clubs (Berghain, Robert Johnson, Pudel Club, Rote Sonne, etc.). Im Berliner Theater Hebbel am Ufer betrieb er von 2007 bis zum ersten Lockdown 2020 die dialogische Veranstaltungsreihe „Plattenspieler“, seit Herbst 2022 wird die Reihe an der Berliner Volksbühne fortgesetzt. Im Wintersemester 2011/12 hatte er an der Goethe-Universität, Frankfurt am Main die Poetikdozentur inne („Ich als Text“, edition suhrkamp, 2012). Aufenthalte an Universitäten in Europa und den USA. Zuletzt: Writer in Residence an der University of St. Andrews, Schottland, Poetik-Dozentur Gender an der TU Braunschweig. Zahlreiche Auszeichnungen, 2020 der Berliner Literaturpreis (mit Gast-Professur an der FU im Sommersemester 2022). 2021 erschien ein „Text + Kritik“ Band über Thomas Meinecke, 2022 der poetologische Reader „Ozeanisch Schreiben“ (im Verbrecher Verlag).
Wir gingen, Agathe, meine Mutter und ich,
auf einem Höhenweg von rötlicher Sandsteinfarbe,
wie sie mir von Amorbach vertraut ist.
Aber wir befanden uns an der Westküste Amerikas.Theodor W. Adorno