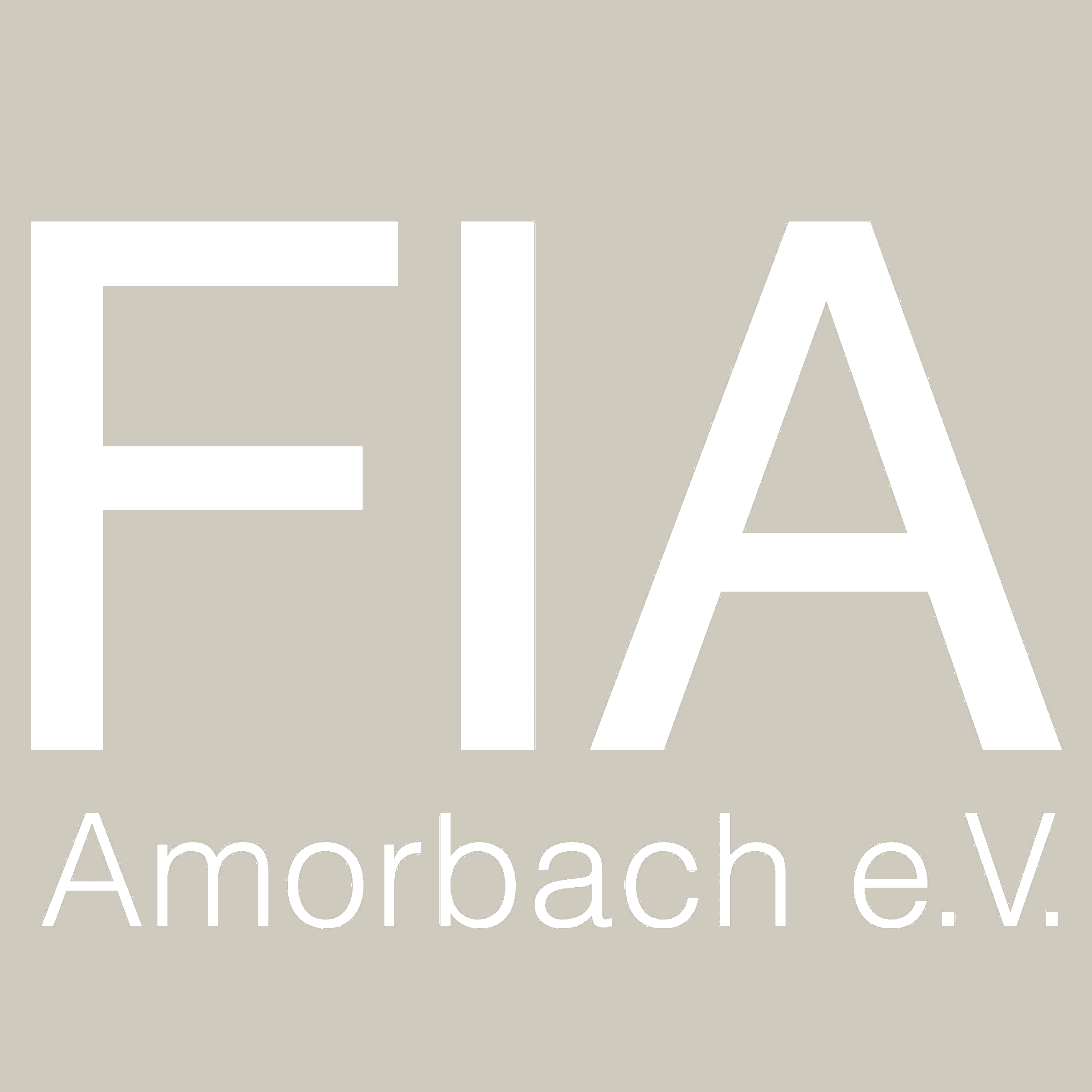Ansprache anlässlich der Ausklangveranstaltung zur Verabschiedung der Adorno-Stipendiaten Amorbach, Altes Rathaus, Foyer
Nicole Jänes, Elizabeth Thallauer, Annika van Vugt
Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Gründe, um nach Amorbach zu reisen. Theodor Adorno verbrachte hier, in der Sommerfrische, die schönsten Tage seiner Kindheit. Die Schriftstellerin Christine Scherer, die sich Adorno zu Ehren das Pseudonym Thea Dorn gegeben hat, lässt eine Journalistin auf Mordrecherche in den Odenwald rasen. „Ich muss nach Amorbach“, sagt die Berlinerin im Roman Die Hirnkönigin beschwörend zu dem indischen Taxifahrer, der keine Ahnung hat, wohin es gehen soll. „Fahren Sie mich nur nach Amorbach. Ich sag Ihnen, wo’s langgeht“. 1
Und als sie endlich im Odenwald sind, wecken die wundersamen Ortsnamen, Erlenbach, Klingenberg, Kleinheubach 2 beglückende Kindheitsassoziationen.
Erinnerung und Kindheit sind auch für Adorno die Zauberworte für dieses Amorbach, wo die im Kaiserreich recht strengen Regeln der Eltern- und Schulwelt außer Kraft gesetzt schienen.
Amorbach war ein Gegenpunkt zur kalten, trostlosen Welt, zum „Leben das nicht lebt“. 3
Das kleine Städtchen wurde ihm zum Synonym für das Glück, für die Sehnsucht nach der Wärme der Kindheit und zugleich zu einem Springquell seiner Philosophie. Hier schon erwuchs dem jungen Adorno eine mögliche Alternative zur herrschenden Ordnung, hier erahnte er den „Traum einer von Zwecken nicht entstellten Welt“, 4
einer nicht entfremdeten, friedlichen und lebenswerten Welt, die auf „Respektspersonen“ verzichten kann, weil im Odenwald alle Menschen einander respektieren. Amorbach mit seinen Wäldern und Wildsauen prägte Adornos Bild von einer Natur, die sich vom Menschen nicht restlos domestizieren ließe, und führte dem Kind gleichzeitig vor Augen, was mit wilder Natur tatsächlich geschah – die Tiere wurden ja nicht um ihrer selbst willen gefüttert, sondern um den Jägern ihre Beute zu erhalten. 5
Und dann die Musik: Das liebenswürdige Stadtporträt von Amorbach, das der Philosoph später schrieb, ist ganz in die Sphären der Wagner‘schen Mythologien und Melodien getaucht, als seien ihm die Nibelungen in den Tiefen des Odenwaldes wirklich begegnet. 6
Die Schönheit des Ortes und das Glück, das er spendet, ist nicht davon zu trennen, dass die Lebensgeschichte Adornos sich mit dem Zauber der Stadt legiert hat, dass sie hier, nur hier in einer Kreisbewegung versöhnt in sich zurückkehrt, wie Adorno am 24. September 1949 an seine Mutter schreibt: 7
„Es war keine Absicht, aber nun will es mir doch symbolisch erscheinen, dass ich Deinen fünfundachtzigsten Geburtstag in Amorbach verbringe. Es ist schließlich doch das einzige Stückchen Heimat das mir blieb – äußerlich ganz unverändert und womöglich noch verschlafener als früher.“
Längst hat sich und wurde der Ort aus seinem Dornröschenschlaf wachgerüttelt; seit 2015 auch mit einer Künstlerresidenz für junge Absolventen, die sich hier zu einem 4-monatigen Aufenthalt niederlassen – das ist dann wie die Sommerfrische eine Zwischenzeit und doch etwas anderes: Während man zur „Sommerfrische“ aufzubrechen pflegt – meist aus der näheren Umgebung, startet eine „Residency“ erst mit dem Antritt vor Ort. Zwischen Aufbrechen und Antreten liegen Welten. Hier die Vorfreude auf eine gedehnte, leichte, milde Zeit, zu der schon der Weg dahin einem erfrischenden Reinigungsritual gleichkommt. Dort der Geschmack von Kommissbrot. Trocken und hart. Beides scheint unvereinbar, bis die ungleichen Anfänge zu etwas Offenem zusammenfallen: Zum Aufenthalt. Einmal begonnen schöpfen beide aus dem Ort, um dann, wenn sie wieder gegangen sind, einerseits ihre Spuren hinterlassen zu haben, andererseits lange vom Mitgebrachten zu zehren.
Gerade am Beginn der künstlerischen Tätigkeit kann der Abstand von der gewohnten Umgebung sehr bereichernd sein. Der Perspektivwechsel, der Bruch mit der Routine, der Austausch mit den Kollegen, die Konzentration auf die eigene Arbeit kann künstlerische Prozesse präzisieren, beschleunigen und manchmal radikal verändern, Impulse geben, zumal wir auch in der Kunst Ohne Leitbild sind. Es gibt keine abstrakten, statischen Normen mehr. Es gibt kein pausbäckiges richtig oder falsch. Dennoch gibt es Kunst, Kunstwerke, die ein vertieftes Sehen möglich machen, die uns bereichern, im Sehen, in einem Betrachten, das nicht auf vorgefertigte Antworten stoßen und neue, innere, eigene Vorstellungen von Kunst und Welt hervorbringen lässt. Bildung beginnt mit Imagination, mit Einbildung, die die Eigenheit der Dinge gewahr werden lässt.
Auf notorische Weise entziehen sich die Kunst, die Künste ihrer Bestimmbarkeit. Darin mag auch die von Adorno immer wieder aufgerufene Rätselgestalt der Kunst liegen, ihre Signatur ist der Riss. In seinem Essay, Die Kunst und die Künste, notiert Adorno, dass die Grenzen zwischen den Kunstgattungen porös werden, dass sich ihre Demarkationslinien verfransen, dass sich immer neue Verflechtungen, Überlagerungen, Anschlussstellen und Scharniere ergeben. Im Experiment, im wagemutigen Neu- und Anderssehen, im Bruch, so könnte man mit Adorno sagen, findet die Möglichkeit des Künstlerischen immer noch und immer wieder neu ihre Zuflucht. 8
In diesem Sinne haben sich die diesjährigen Gäste, drei Künstlerinnen, auf Amorbach, auf seine Bewohner, auf seine Geschichte eingelassen – sie sind nicht gekommen, um drinnen zu sitzen. Sie gingen außer Haus und setzten sich aus.
Im coup d’oeil, im Augenblick des Sehens entfaltet Nicole Jänes ein vielstimmiges Ereignis – durch ihre Raumzeichnungen mit farbigen, elastischen Strumpfhosen. Die Künstlerin arbeitet mit Hüllen und Grenzen zwischen Innen und Außen, mit Körper und Raum und akzentuiert durch ihre Interventionen, ihre Geflechte vertraute Gebäude keck und neu und natürlich ist
das Spiel mit den Gegensätzen von Öffnung und Füllung, mit Addition und Konglomeration, mit Spiegelung und Theatralisierung, das spannende Werden und die Verspannung dieses Werdens mit dem Raum Erfindungen des in Amorbach so präsenten Barocks, die Nicole Jänes neu und unbefangen einsetzt.
Auch Elizabeth Thallauer spielt mit Gegensätzen, mit Zeit und Ewigkeit, mit Licht und Dunkel, mit Rücksicht und Voraussicht. Ihre „Welle“, entstanden in einem fast meditativen Prozess, besteht aus blauen Folien, die umgeformt und geschmolzen wurden. Die Skulptur ist ein dynamisches Bild und Möglichkeitsfeld, das die Formbarkeit und Veränderung aller Gestalt reflektiert. Wie das Bild ist auch die Sprache ein Instrument zur Welterfassung, und Worte changieren, übersetzen, sind Überfahrt und Abstraktion, schaffen Wege und Verbindungen – im dem mit Tafeln, die den Lobpreis der Stadt und Orte in kleinerem Umkreis in den Wappenfarben werbeträchtig verkünden, gesäumten Weg fallen die Sprache und Bild, Realität und Vorstellung gleichsam in eins. Und wenn diese Tafeln über die Grenzen Bayerns wandern, werden Ferne und Nähe – die Grunderfahrungen vielleicht auch einer Künstlerresidenz – in ein irritierendes befragendes Verhältnis gebracht: Wie weit ist die
Nähe, wie nah ist die Weite? Alles spiegelt sich erneut im Fluss der Erfahrungen.
Annika van Vugt hat sich den Menschen dieser Stadt zugewandt. Es entstand eine Serie von Porträts von Amorbachern, die sich mit Freuden als Modell zur Verfügung stellten. Jedes Porträt schafft ein Abbild und dieses Bild des Menschen hat immer mit zwei Problemen zugleich zu tun: es geht einmal darum, die Wirklichkeit, die Erscheinung zu fassen, dann aber soll auch das innere Wesen der Person im Bild sichtbar werden. Im Begriff ‚Porträt‘, der ja von ‚protrahere‘, herausziehen kommt, ist diese Doppelheit bereits angelegt: ein Nichtsichtbares soll sichtbar werden, gerade in der Darstellung der Wirklichkeit und zugleich und das ist der Konflikt – wird in der Darstellung die Figur interpretiert, ihr Wesen beleuchtet. Im Verlauf der Entwicklung des Porträts wird diese doppelte Anliegen immer wieder neu ausbalanciert, zeitgenössisch ästhetische Erfahrungen zur Frage nach dem Menschenbild werden jeweils in der Darstellung selbst neu übersetzt und reflektiert. Jedes
Porträt ist ein Schaufenster in die Person hinein, und so entwarf Annika van Vugt zudem ein Album, in dem schaufensterartig die einzelnen Personen in Vierzeilern (Berufsstand, persönliche Vorlieben, Träume, Visionen) beschrieben und in die komprimierte Form eines Sammelheftchens gebracht werden.
Frei und offen, mit leichter Ironie, heiter flottierend und ohne Scheu vor waghalsigen Zusammenstellungen arbeiteten die Künstlerinnen für vier Monate in Amorbach und setzten so den immer unabwägbaren Impuls der Kunst ins Recht: Kunst als ein Potenzial in ständiger Re-Modellierung. Mit Adorno sind Kunstwerke Kraftfelder, Gegensätze kommen zum Austrag, 9 Aufgespeichertes wird erweckt, reanimiert: In den vielschichtigen Inventuren im Stadtraum erspielen die Stipendiatinnen die im Sehen verflochtene Korrespondenzen, wobei die plastische Gestalt den Ort nicht einfach einrichtet, sondern Offenes, Überraschendes zulässt, sich auf Unabgeschlossenes einlässt.
1 Thea Dorn, Die Hirnkönigin, München 2001, S. 263
2 Ebenda, S. 264
3 Ferdinand Kürnberger, Der Amerikamüde. Die Gedichtzeile wurde von Theodor W. Adorno dem ersten Teil
der Minima Moralia vorangestellt.
4 Theodor W. Adorno, Brief an Thomas Mann, 3. Juni 1945, zitiert nach Reinhard Pabst, Adorno. Kindheit in
Amorbach, Frankfurt am Main, S. 11
5 Theodor W. Adorno, Amorbach, In: Ohne Leitbild, Frankfurt am Main, S. 27
6 Siehe ebenda, S. 21
7 Theodor W. Adorno, Brief an die Mutter, 24. September 1950, zitiert nach Reinhard Pabst, Adorno. Kindheit in
Amorbach, Frankfurt am Main, S. 214
8 Siehe dazu Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild, Frankfurt am Main 1967, S. 19
9 Ebenda, S. 11
Dr. Dorothée Bauerle-Willert, Ansprache anlässlich der Ausklangveranstaltung zur
Verabschiedung der Adorno-Stipendiaten Amorbach, Altes Rathaus, Foyer, 2017
Link zu Adorno-Stipendium 2017