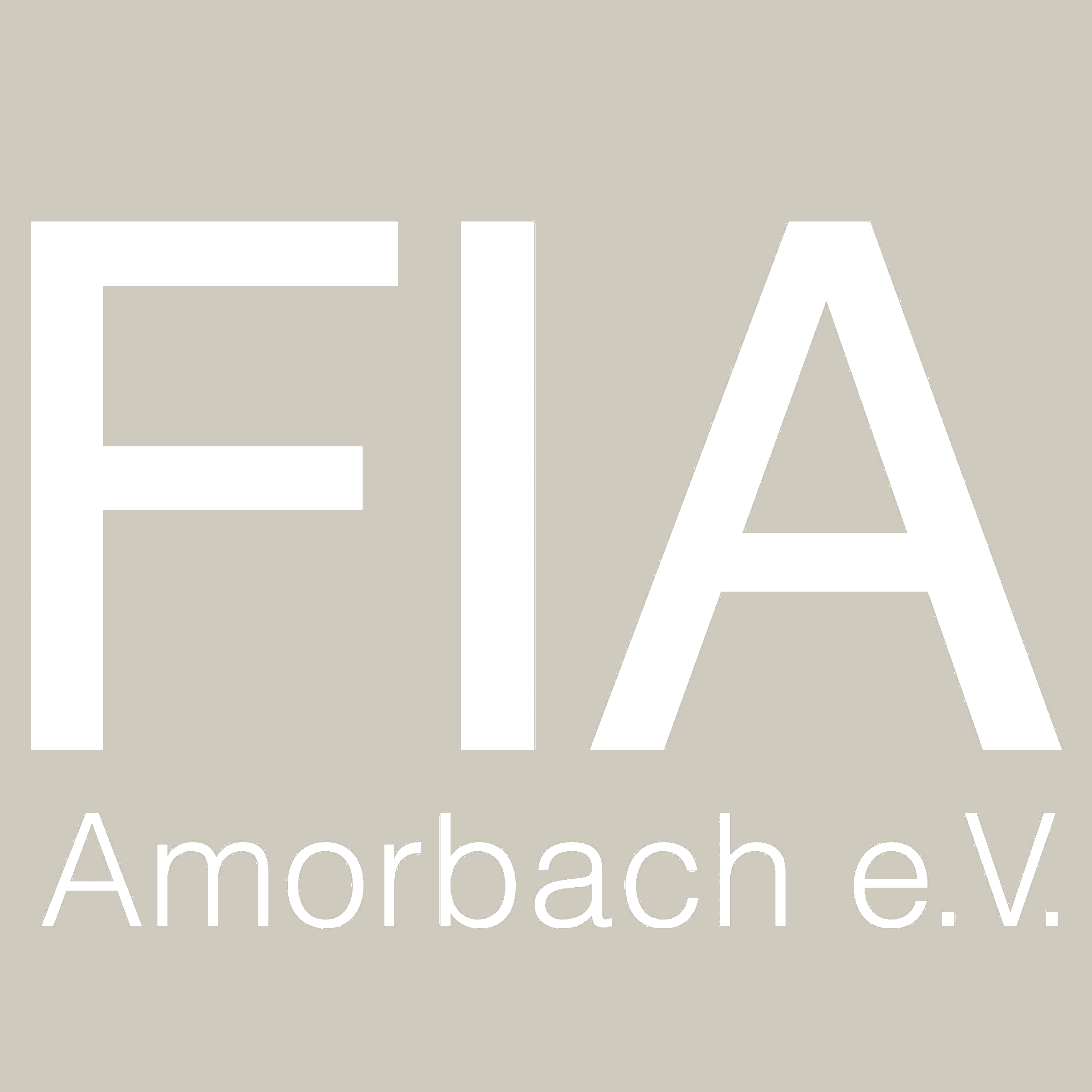mit dem Pianisten Fukuma.
Kotaro Fukuma – Klavier
Dr. Michael Fürtjes – Lesung
Veranstalter: Kulturwochenherbst – Landratsamt Miltenberg, Grüner Saal der Leiningenschen Abtei , 10. November 2019
Hommage an T.W. Adorno, Thomas Mann und Beethoven.
Eine Kombination aus Wort und Musik, zelebriert von Michael Fürtjes,(Rezitator) und vom Pianisten Kotaro Fukuma am Bösendorfer-Flügel.
Amorbach. Es gibt Veranstaltungen, die man nicht so schnell vergisst: Die Konzertlesung am frühen Sonntagabend im Grünen Saal in Amorbach vor gut 120 Zuhörern gehört ganz sicher dazu. Ein schöner Nebeneffekt: Alle Bedenken, das anspruchsvolle Thema könnte nur wenige Besucher beim Kulturwochenherbst an locken, wurden schnell widerlegt: Qualität setzt sich eben doch durch und man sollte das Publikum nicht unterschätzen!
Es ging um nicht weniger als um die Beziehung zwischen Thomas Mann und Theodor Adorno, die sich 1943 im Exil in Santa Monica begegneten, der weltbekannte Großschriftsteller und der Philosoph aus Deutschland, den damals in Kalifornien kaum jemand kannte. „Heute abend bei Max (Horkheimer) mit ein paar Großkopfeten, darunter Thomas Mann nebst holder Gattin“ schrieb Adorno im März 1943 an seine Eltern. Dann kamen sich beide doch näher und der 28 Jahre jüngere Adorno konnte auf einem Gebiet Manns Interesse gewinnen – auf dem der Musik. Adorno nämlich war sich lange nicht schlüssig, ob er eher den Spuren Beethovens oder denen Hegels folgen soll – heute weiß man, welchen Weg der vor 50 Jahren Gestorbene einschlug, auch wenn in seinem Gesamtwerk die Schriften zur Musik mehr als ein Drittel einnehmen.
Der konkrete Anlass für die intensiven Gespräche: Mann schrieb an seinem Roman „Dr. Faustus“ über den Tonkünstler Adrian Leverkühn und schuf darin eine ganz seltene Synthese zwischen Literatur und Musik.
Da war ihm ein Experte und Ratgeber wie Adorno höchst willkommen, Schüler Alban Bergs und Theoretiker der Neuen Musik – bis hin zur Zwölftonmusik Schönbergs. Große Teile, vor allem des achten Romankapitels, wären ohne Adornos Beiträge, die Mann z.T. wörtlich übernahm, so nicht denkbar. Dass Manns älteste Tochter Erika alles dafür tat, den Anteil Adornos in der Öffentlichkeit möglichst herunterzuspielen, hat daran nichts ändern können.
Die zwei Akteure der Konzertlesung präsentierten Gründe und Abgründe dieser schwierigen Beziehung viel anschaulicher und vor allem viel unterhaltsamer als es unzählige wissenschaftliche Untersuchungen in sie ben Jahrzehnten vermocht haben. Dr. Michael Fürtjes, Rezitator und engagierte Thomas Mann-Liebhaber, ließ in knapp zwei Stunden zusammen mit dem großartigen japanischen Pianisten Kotaro Fukuma in einer idealen Kombination aus Wort und Musik alles lebendig werden, was man über Manns Romankapitel und über Adornos Haltung zur Neuen Musik wissen sollte. Fürtjes schlüpfte in die Rolle des Dichters, der ein begnadeter Vorleser seiner eigenen Werke war, und zelebrierte weite Teile des achten Kapitels aus dem „Dr.Faustus“. Er spielte ihn nicht, er war Wendell Kretzschmar, der Musiklehrer Adrian Leverkühns, der dem Publikum in einem begeisterten, von Stottern unterbrochenen Vortrag die Hintergründe der letzten Sonate Beethoven erklärt.
Im typischen Mann-Sound mit der leisen Ironie, die Fürtjes perfekt imitierte: „… Nun, der Mann war imstande, eine ganze Stunde der Frage zu widmen, ‚warum Beethoven zu der Klaviersonate op. 111 keinen dritten Satz geschrieben habe‘, – ein besprechenswerter Gegenstand ohne Frage …“
Ein Pianist der Extraklasse: Kotaro Fukuma interpretierte Beethovens letzte Sonate technisch brillant, beseelt und hochkonzentriert am Bösendorfer-Flügel im Grünen Saal.
Der 37-jährige Pianist, der schon in allen großen Häusern von der Carnegiehall bis zum Gewandhaus aufgetreten ist und heute in Berlin lebt, interpretierte mit einer wunderbaren Mischung aus technischer Brillanz und sensibler Ausdrucksstärke drei kleine Klavierstücke Adornos, die erste Klaviersonate von Adornos Kompositionslehrer Alban Berg und schließlich – als absoluten Höhepunkt nach der Pause – Beethovens Werk op. 111, seine letzte Sonate, die mit ihren zwei Sätzen als Gipfel und zugleich als Ende der Sonatentradition gilt.
Vor der Pause hatte Fukuma immer wieder kleine Passagen der Klaviersonate in den Vortrag des stotternden Wendell Kretschmar eingebaut – eine höchst an schauliche und zugleich erhellende Kombination aus Wort und Ton.
Auszüge aus einem Presseentwurf von Dr. Heinz Linduschka

Literaturwissenschaftler
Michael Fürtjes liest das achte Kapitel aus dem Roman „Dr. Faustus“
Der Pianist Kotaro Fukuma
interpretierte mit einer wunderbaren
Mischung aus technischer Brillanz und sensibler Ausdrucksstärke drei kleine Klavierstücke Adornos, die
erste Klaviersonate von Adornos Kompositionslehrer Alban Berg und schließlich – als absoluten Höhepunkt
nach der Pause – Beethovens Werk op. 111 am Bösendorfer-Flügel.
Fotos: Heinz Linduschka

Michael Fürtjes: „Beethovens letzte Klaviersonate op. 111 war für Adorno sehr wichtig. Er hat Thomas Mann für das Kapitel VIII des „Doktor Faustus“ erläutert, wie er diese Sonate versteht. Adornos Ausführungen dazu hat Thomas Mann zum Teil wörtlich übernommen.
Im von Adorno nicht mehr fertig gestellten Beethoven Buch geht es u.a. auch um diese Sonate. Die Fragmente des geplanten Buchs gibt es als Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft Band 1727. Im Register des Buches sind 13 Stellen zu op. 111 angegeben. Entscheidend ist jedoch der Aufsatz „Spätstil Beethovens“ (stw 1717, Seite 13). Diesen Text hat Adorno im Exil Thomas Mann vorab gegeben. Ich habe das damals als Einführung zur Konzertlesung vorgetragen“.
Einführung: Als ich vor gut einem Jahr im Rahmen einer Führung zum ersten Mal in diesem wunderschönen Raum war und hörte, dass er auch für Konzerte genutzt wird und auf meine Frage hin erfuhr, dass ein Flügel vorhanden sei, entstand sogleich mein Wunsch, hier gemeinsam mit Kotaro Fukuma ein Projekt zur Aufführung zu bringen, das uns schon seit geraumer Zeit vorschwebte, nämlich Beethovens letzte Klaviersonate und die darauf bezogene Passage aus Thomas Manns „Doktor Faustus“ miteinander in einer Konzertlesung zu Gehör zu bringen. Und zugleich war mir klar – schließlich war ich in Amorbach -, dass eine solche Aufführung durch Musik Theodor W. Adornos besonders interessant werden würde, im Sinne des Wortes „unerhört“, wenn wir das einmal als Synonym zu „ungehört“ nehmen wollen.
Der 50. Todestag Adornos in diesem Jahr und der 250. Geburtstag Beethovens im nächsten Jahr waren uns Anlass genug, ein solches Programm zügig zu erarbeiten.
Dass Adorno auch komponiert hat, ist möglicherweise dem einen oder anderen vage im Bewusstsein; doch gehört haben seine Musik wohl nur wenige. Sie ist allenfalls musikwissenschaftlichen Experten bekannt. Umso reizvoller erschien es uns, aus seinem kleinen Klavierwerk etwas zu Gehör zu bringen. Und weiterhin schien es uns nahe zu liegen, die Klaviersonate Alban Bergs ins Programm zu nehmen, denn bei ihm hatte Adorno Komposition studiert.
Die Zusammenarbeit von Adorno und Thomas Mann im amerikanischen Exil beim Roman „Doktor Faustus“ ist hinlänglich bekannt und in der zahllosen Sekundärliteratur zu diesem Werk immer wieder dargestellt und diskutiert worden. Ich möchte dazu nur ein paar Daten in Erinnerung rufen:
Thomas Mann lernt den 28 Jahre jüngeren Adorno im Hause Horkheimers im Juli 1943 persönlich kennen und erhält von Adorno dessen Typoskript des Aufsatzes „Schönberg und der Fortschritt“, der später zum ersten Teil der „Philosophie der neuen Musik“ wird. Thomas Mann liest außerdem sehr aufmerksam den Aufsatz Adornos von 1937 „Über den Spät-Stil Beethovens“ und lädt den Autor im September in sein Haus ein, liest ihm das Kapitel VIII des Romans vor und berücksichtigt in den folgenden Wochen die Hinweise Adornos bei mehrmaligen Umarbeitungen des Kapitels.
Nach Erscheinen des „Doktor Faustus“ im Oktober 1947 in den USA und im Februar 1948 in Deutschland erfährt Beethovens letzte Klaviersonate besondere Aufmerksamkeit. Der bekannte Musikkritiker Joachim Kaiser soll festgestellt haben, dass diese Sonate nach dem Erscheinen des Romans deutlich häufiger in Konzerten zu hören war als zuvor.
Adornos Deutung dieser Sonate ist zum Teil wörtlich in den ersten Teil des Kapitels VIII von Thomas Mann übernommen worden. Er konnte als musikalischer Laie wohl nicht richtig beurteilen, ob Adorno die Sonate zutreffend analysiert und gedeutet hatte. Es gibt in der Sekundärliteratur Hinweise auf Fehldeutungen Adornos. Für Thomas Mann hätte die Kenntnis davon womöglich nicht viel geändert, denn das, was Adorno ihm zur Sonate op. 111 vermittelte und was er ihm für den weiteren Verlauf der Komponistenbiographie Adrian Leverkühns an die Hand gab, passte zu seiner Idee von diesem Spätwerk, das wie kein anderes Werk des Schriftstellers Gegenstand akribischer Forschung und kontroverser Deutungen geworden ist.
Nicht fehlen sollte heute Abend der Hinweis darauf, dass Thomas Mann selbst die musiktheoretischen Passagen seines Romans so schreibt, dass sie von feinsinnigem Humor durchzogen, also alles andere als eine trockene Abhandlung sind. Auch in diesen Passagen trägt Thomas Mann ein „wenig höhere Heiterkeit“ in die Welt, was er als seine Berufung begriffen hat.
Am Tag davor, am 9. November 2019 veranstaltete die FIA ein Seminar/ Workshop im
Musiksaal des Karl-Ernst-Gymnasiums mit
Prof. Dr. Friedrich A. Uehlein
Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik. Eine Einführung