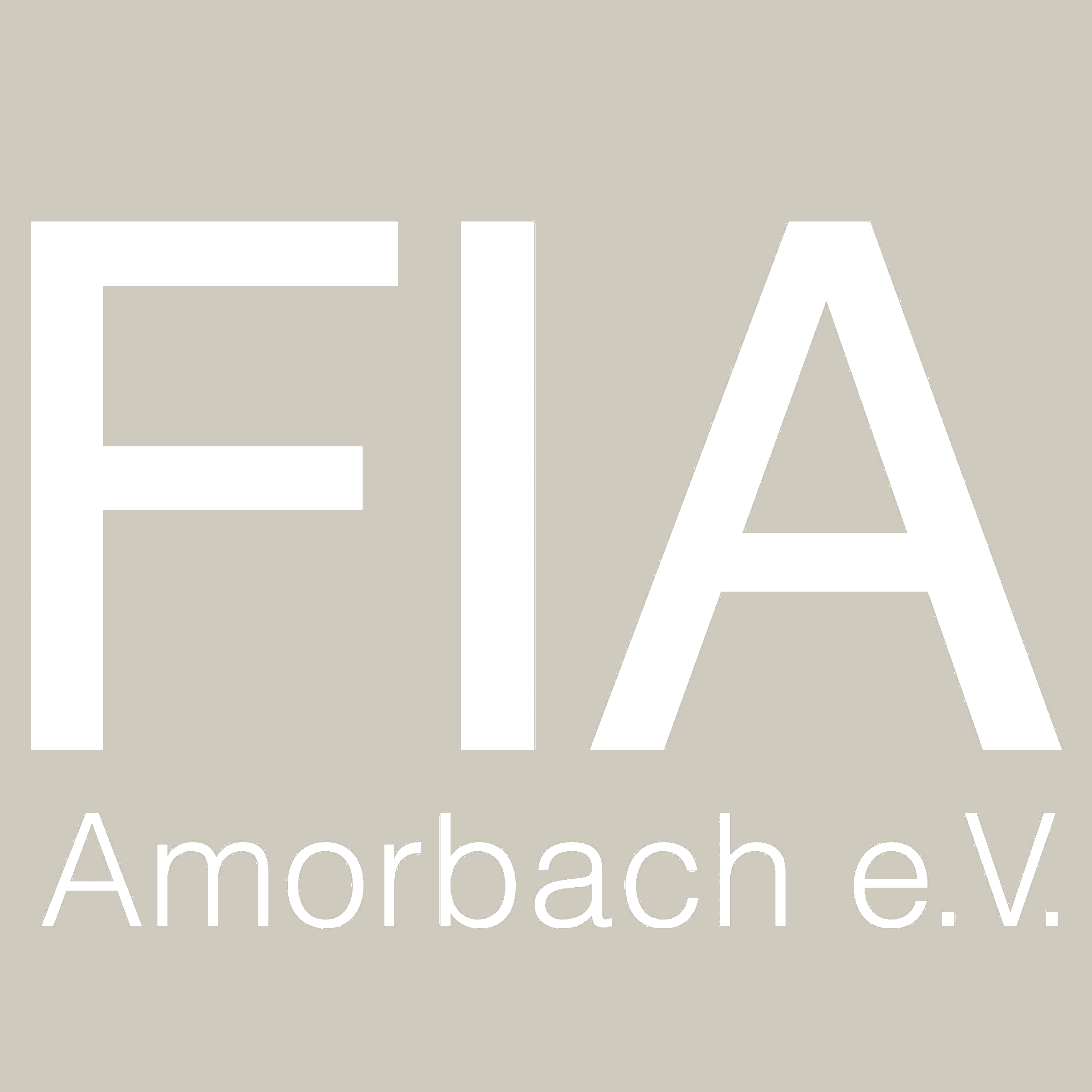Ansprache anlässlich der Ausklangveranstaltung zur Verabschiedung der Adorno-Stipendiaten Amorbach
Fürstin zu Leiningen, sehr geehrter Landrat Scherf, sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmitt, liebe Ina, liebe Helin, lieber Maximilian, liebe Anna, meine sehr geehrten Damen und Herrn,
Ich freue mich sehr, heute zum Abschluss des Adorno Stipendiums ein paar Worte sagen zu dürfen und im Anschluss dann das Künstlergespräch zu moderieren in diesem prunkvollen Grünen Saal der sicherlich zu den schönsten Räumen gehört, in denen ich je gesprochen habe – und ich habe an vielen Orten gesprochen in meinem Leben.
Was die Kunst sei, ergibt sich nur durch die Künste, schrieb Theodor W. Adorno in seinem Essay Die Kunst und die Künste. Die Künste sind gegenüber der Kunst ein sich Entwickelndes, ein sich Bildendes. Das heißt, es gibt kein festgeschriebener Begriff von Kunst, sondern jedes Kunstwerk setzt sozusagen den Begriff neu ins Werk, setzt neue Voraussetzungen, neue Bedingungen dessen, was wir im Stande sind wahrzunehmen, zu sehen. Wahrnehmung ist kein statischer Begriff, sondern viel eher ein Bewegungsbegriff. Im Wahrnehmen, in der Änderung unserer Wahrnehmung trifft Sinn auf unsere Sinne. Aus den
potentiell unendlichen Möglichkeiten der Künste lässt sich also keine einheitliche Kunstauffassung ablesen, wohl aber eine Serie von Ereignissen, die sich laufend verwerfen, umwenden und anders ansetzen. Sie vollbringen – so das treffende Bild von Josef Beuys – plötzliche „Hasensprünge“, ein Prozess der nicht ans Ende kommt. Es gibt also keinen festgeschriebenen Begriff von Kunst mehr und es gab ihn nie, auch wenn wir dazu neigen, dies zu erwarten.
Vielmehr gibt es eben die ständige Prozessualität, ein ständiges Experiment, in dem Neues und Altes sich verweben.
In seinem Essay Ohne Leitbild notiert Adorno, dass das Experiment vielleicht der einzig Ort sei, in dem die Kunst noch Zuflucht findet. Wir sind auch in der Kunst ohne Leitbild. Dies ist der Titel einer Essaysammlung, in dem auch die Miniatur Amorbach enthalten ist. Dieses Amorbach, das für Adorno der einzige Ort auf diesem fragwürdigen Planeten war, der für ihn noch so etwas wie Heimat bedeuten könnte. Heimat: Kunst hat damit zu tun. Wir gehen hinaus, wir kommen zurück.
In diesem Sinne haben sich die Künstler, die wir heute hier gleich hören und von denen Sie ja schon allerhand gesehen haben, eingelassen auf das Experiment Amorbach.
Eine Residency ist ja immer auch eine merkwürdige Sache. In Residenz steckt ja auch der Rest oder der Überfluss, das Residuum dessen, was nicht hier ist und nicht dort. Künstler kommen von irgendwo her, sind eine Zeitlang an einem Ort, sind hier sozusagen eingepflanzt wie der Rest in dem Wort von Residenz eingepflanzt ist. Und in diesen ständigen Translocationen, die ja Künstler heutzutage unternehmen müssen, ergeben sich immer wieder auch neue Konstellationen, neue Angebote. Kunst ist immer auch ein Angebot zu einem Dialog, eine Einladung in einen wie immer von einem Künstler gestalteten, initiierten festlichen Raum. Die Künstler sind jetzt für eine Zeitlang hier beheimatet gewesen, setzten sich auf vielfältige Weise mit diesem Ort, mit der Stadt, für die Stadt und in der Stadt auseinander und entstanden ist eine Serie von Arbeiten, die subtil, hintergründig, subversiv sowohl den Begriff der Kunst und des Sehens auf die Waagschale wirft und uns dadurch wie immer neu sehen lehrt.
Helin Alas und Maximilian Schmölz haben das Schwimmbad sozusagen zu ihrem Forum, zu ihrer Bühne gemacht und zu einer Reihe von Inszenierungen Menschen eingeladen, die durch performative Vorstellungen zu hintergründigen, heiteren, herausfordernden Seherfahrungen aufforderten. Wie Regisseure haben sie einzelne Elemente aus diesem unendlichen Potential, das die Kunst vorstellt, herstellt, immer wieder neu ausfaltet, ins Werk gesetzt, Kunstwerke als Ereignisse choreografiert. Es gab vielerlei zu sehen, vielerlei zu erleben und all diese Inszenierungen und Interventionen der Künstler kommen darin überein, dass sie unsere Wahrnehmung und unseren oft hausbackenen Begriff von Kunst neu überprüfen und
sozusagen ins Trudeln bringen. Es gibt eine Edition von Handtüchern, die zwischen dem Nutzobjekt Handtuch und einem Bildobjekt changiert. Es gab eine kollektive Skulptur, es gab Eis zu kosten, es gab zu hören. In dieser Reihe der inszenatorischen Eingriffe wurden wie bei einem Fest alle Sinne angesprochen und konnten sich in einer Choreografie des Erlebens, des Neu-Erlebens des traditionellen, auch des rituellen Orts Schwimmbads zusammenschließen.
Das Schwimmbad verbindet sich auch mit Kindheitserinnerungen: Wir alle waren ja als Kinder im Schwimmbad, wir alle wollten jeden schönen Sommertag im Schwimmbad verbringen. Adorno sagte, dass
„das, was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch, die Kindheit verwandelnd einzuholen.“
Diese Facette des Wiederholens, die Frage nach der Repräsentation wird – auf anderer Ebene auch im Schwimmbadmagazin gestellt, wo durch die Abweichungen der Wiedergabe die Frage nach dem „Richtig oder Falsch“ des Bildes unterminiert wird. Ein Wiederholen als Neu- und Anderssehen, neu- und anders Erleben ist in dieser festiven Anordnung der Künstler
Helin Alas und Maximilian Schmölz aufgehoben. Ihre Anregungen und Stimuli machen den Besucher zum Mitspieler, der sich dann die Frage nach der Kunst, ihren Grenzverläufen und ihrer Wahrnehmungspotentiale sozusagen neu erspielt.Kunst ist Kommunikation – und das ist ja auch das Wesentliche einer Residency, eines Aufenthaltes, dass er versucht, sowohl die Künstler, die an einen ihnen fremden Ort kommen, als auch die Menschen, die die Künstler bewillkommnen in ein Gespräch, in einen nicht festgeschriebenen, immer offenen, auch im Ergebnis offenen Dialog zu bringen – so wie wir
in jedem freien Gespräch neue und andere Weisen des Lebens, des Seins in dieser Welt erfahren.
Ina Bauer hat in einem offenen Studio gearbeitet. Sie ist Bildhauerin. Sie arbeitet subtil und frei an der Frage – und das hat natürlich auch wesentlich mit Sehen, mit zu Sehen-geben, mit dem anders sehen zu tun – des Raums und Umraums der Skulptur, der offenen und geschlossenen Form, des Materialmimikry. Man sieht etwas, man denkt, man hätte das
Konstruktionsprinzip, die Materialität des Objekts verstanden, wird dann aber – zum Beispiel in ihrem temporären Ausstellungsraum – beim genauen Hinsehen inne, dass das Pappgebilde sich als Guss einer Pappkonstruktion erst entpuppt. Auch hier geraten Wahrnehmungsmuster ins Schlingern. Auch hier wird der Ausstellungsort zur Bühne, ähnlich wie das Schwimmbad sozusagen zur Bühne wurde: der Raum gerät durch diese Bodenskulptur, die eine architektonische Voraussetzung aufgreift, in Fluss, ins Fließen. So wie unser Sehen bei Bildern, Ereignissen, Performances immer in Fluss gerät durch solche Fließfiguren des anschaulichen Denkens, wie sie hier entstanden sind.
Ina Bauer hat zudem en passant Güsse einer Magnoliensamenstaude in die Stadt eingeschmuggelt und so Orte, die für sie wichtig, bedeutend, schön wurden, markiert. Eine subtile Spurensetzung, die wir dann wiederum als Betrachter in der Spurensuche der Orte, die für Ina eine, wie immer rätselhafte, Bedeutung angenommen haben, nachvollziehen können.
Auch ihre Poller, die Nachbildungen eines antiken Pollers, gleichsam des plastischen Großvaters der heutigen serienmäßig gefertigten Poller, stellen im Schaufenster ihres Raums die uralte Frage nach der Grenze zwischen dem Kunstwerk und dem Ding, dem Artefakt, dem vom Menschen gemachten und dem Natürlichen, noch einmal neu. Vielleicht hängt mit solchem unabschließbaren Potential der Kunst und des Sehens zusammen, was Adorno die Rätselgestalt des Kunstwerks nannte, das sich hartnäckig und obstinat je und je der Bestimmbarkeit entzieht und in der jeweiligen Setzung, in der Fragestellung neue Anschlussstellen, neue Scharniere, neue Überblendungen und neue Facetten dessen, was Kunst sei und sein könnte, erst ausfaltet.
Theodor Adorno hat in seinem Essay über Amorbach in einer wagemutigen Volte noch einmal die Frage nach dem Leitbild aufgegriffen: Im Ernsttal trug sich für die Eisenbahnpräsidentengattin, Frau Stapf der Ernstfall zu. Im neuen roten Sommerkleid
spazierte sie durch das Gehege mit den gezähmten Wildsauen. Eine Wildsau jedoch vergaß ihre Zucht, nahm die lautschreiende Eisenbahnpräsidentengattin auf den Rücken und raste davon. Adorno notierte zu diesem Vorfall: Hätte ich ein Leitbild, so wäre es diese Sau.
Weder die Kunst noch die Natur lassen sich gänzlich domestizieren. Immer gibt es Brüche, Ausbrüche, Flucht und Zuflucht. Das ist was die Kunst uns gibt.
Ich danke den Künstlern hier, ich danke Anna, und allen Beteiligten, dass es möglich wurde, hier eine neue Wildsau durch die Stadt zu jagen.
Herzlichen Dank.
Dr. Dorothée Bauerle-Willert, Ansprache anlässlich der Ausklangveranstaltung zur
Verabschiedung der Adorno-Stipendiaten Amorbach, Grüner Saal der Fürstlichen Abtei, 24.7.2015
Link zu Adorno-Stipendium 2017